 |
Psychose - Schizophrenie - manisch-depressive StörungEntwicklung - Symptomatik - Therapie |
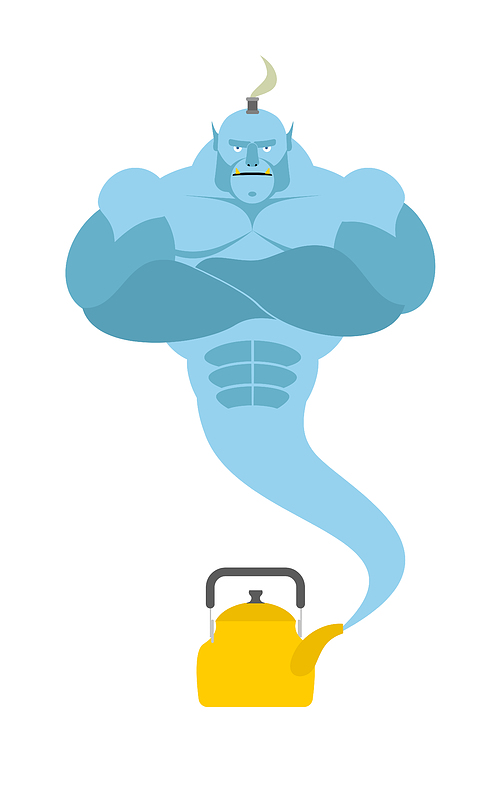
Mit dem Auftreten des Ausdrucks "Psychose" im 19. Jahrhundert begann eine Entwicklung, die in der Gründung eines eigenen Gebietes seelischer Erkrankungen endete. Im Laufe des 19. Jahrhunderts fand der Psychose-Begriff mehr und mehr Eingang in die deutschsprachige psychiatrische Literatur, um seelische Erkrankungen im allgemeinen zu bezeichnen. Erst Ende des 19. Jahrhunderts bildet sich als Ausdruck das gegensätzliche Paar "Neurose-Psychose".
Psychose bezeichnete die Seelenkrankheit, die Neurose hingegen eine Störung des Nervensystems, von denen sich nur bestimmte in den Symptomen einer Psychose ausdrücken können (Jede Psychose ist gleichzeitig eine Neurose, da keine Störung des Psychischen ohne die Verbindung mit dem Nervensystem zum Ausdruck kommt).
Bereits in Freuds ersten Arbeiten findet sich eine gut begründete Unterscheidung zwischen Neurose und Psychose. Freud fasste in einem Manuskript von 1894 die halluzinatorische Verworrenheit, die Paranoia und die hysterische Psychose, unter den Begriff der Psychose (darüber hinaus ging es Freud darum, den Abwehrbegriff zu etablieren und die verschiedenen Formen der Abwehr herauszuarbeiten, die den verschiedenen Störungen zugrunde liegen).
Die moderne Schule der Psychiatrie ist sich weitestgehend einig darüber, was zur Psychose und was zur Neurose gehört.
"In den geläufigen Definitionen [der Psychose] findet man oft nebeneinander Kriterien wie die Unfähigkeit zu sozialer Anpassung (Problem der Hospitalisierung), den Schweregrad der Symptome, die Störung der Kommunikationsfähigkeit, die fehlende Einsicht in den krankhaften Zustand, den Verlust des Kontaktes mit der Realität, den Charakter des nicht
Die zwei häufigsten Formen der Psychose sind einerseits die Schizophrenie und andererseits die Manisch-depressive Störung.

Definition der Psychose: (nach Pschyrembel 256. Auflage 1990) sog. Geisteskrankheit, synonym psychotische Störungen (DSM III); allgemeine Bezeichnung für psychische Störungen mit strukturellem Wandel des Erlebens.
1896 prägte Kraepelin den Sammelbegriff "Dementia praecox" für eine Reihe von psychischen Störungen. Er beschrieb den unaufhaltsamen Verlauf der Krankheit in Schüben und betonte die fortschreitende "Verblödung" als eines der auffälligsten Merkmale.
Bleuler führte 1911 den Begriff "Schizophrenie" ein. Für ihn stand die Beobachtung im Vordergrund, "dass Menschen zunehmend zersplittern und zerfahren können. Er sprach daher von >Spaltungsirresein<, was die Übersetzung von >Schizophrenie< ist" (Dörner/ Plog, 1980, S. 101).
"In psychiatrischen Krankenhäusern stehen die Patienten mit der Diagnose Schizophrenie an zweiter Stelle der Erstaufnahmen mit 20-25%. Gleichzeitig sind mehr als die Hälfte der chronisch hospitalisierten Patienten solche, die ursprünglich die Diagnose Schizophrenie erhalten haben" (Dörner/ Plog, 1980, S. 116). Durch den Einsatz von Psychopharmaka in der Therapie hat sich die Dauer des Klinikaufenthaltes von schizophrenen Patienten deutlich verkürzt.
Die Häufigkeit einer schizophrenen Störung bei Erwachsenen beträgt 0,25% der Bevölkerung pro Jahr (Zahl von 1980). Durchschnittlich sind circa 0,3% der Bevölkerung wegen der Diagnose Schizophrenie in Behandlung.
Insgesamt verstärken sich die Symptome bei circa 1-2% der Bevölkerung an einem Punkt ihres Lebens so, dass sie sich deswegen in psychiatrische Behandlung begeben müssen. Dies tritt am häufigsten im Alter zwischen 20 und 45 Jahren auf.
Seit 1900 hat sich die Psychiatrie weltweit darauf geeinigt, dass folgende Symptome zu beobachten sein müssen, um den Verdacht auf Schizophrenie zu erhärten:
Die Grenzen zwischen der eigenen Person und den anderen sind nicht mehr klar. Der Mensch kann nicht mehr genau sagen, wer er ist und hat das Gefühl, von jemand anderem, der in ihm steckt, beeinflusst zu werden. Eigene Gedanken und Gefühle können schwer von den "fremden" Gedanken abgegrenzt werden, und häufig entsteht der Eindruck, dass die eigenen Gedanken abgezogen werden. Der Patient fühlt sich von außen bedroht und diesen Bedrohungen hilflos ausgeliefert.
Eine solche Symptomatik weist auf eine so genannte Ich-Störung hin und auf eine zugrunde liegende Persönlichkeitsstörung (d.h. der Mensch kann sich nicht mehr als Person mit eigener Identität wahrnehmen). Die Störung des sozialen Kontaktes wird auch häufig als Kontaktstörung bezeichnet.
Es treten Wahrnehmungsstörungen auf. Es werden Dinge als zusammengehörig empfunden, die nicht zusammengehören, und andere Dinge werden als zur eigenen Person zugehörig empfunden, obwohl sie es nicht sind. Auffällig ist auch, dass häufig Wesentliches von Unwesentlichem nicht mehr unterschieden werden kann. Unwesentliche Dinge können eine zentrale Bedeutung erhalten, z.B. bestimmte Geräusche werden in der Weise bedeutungsvoll, dass sie sich von ihnen angesprochen, beobachtet oder bedroht fühlen. Häufig haben sie auch das Gefühl, der Mittelpunkt der Wahrnehmung anderer zu sein.
Manchmal wird auch davon berichtet, dass die Umwelt, andere Menschen, Zeit, Raum, der eigene Körper als fremd, verzerrt, verändert oder nur schematisch wahrgenommen wird. Diese Gefühle der Verfremdung bezeichnet man als Derealisation (Verfremdung der Umwelt) oder Depersonalisation (Verfremdung der eigenen Person).
Darüber hinaus können auch akustische (z.B. Stimmen hören, die nicht da sind) und haptische (fühlt sich berührt, obwohl ihn niemand anfasst) Halluzinationen und ferner auch optische und Geruchshalluzinationen auftreten.
Zu bemerken sind Störungen der Denkabläufe. Hier kann Wichtiges von Unwichtigem nicht auseinander gehalten werden. Das Denken wirkt auf den Beobachter unlogisch und zusammenhangslos, wobei auch oft Gedanken einfach weg sind oder Gedankensprünge festzustellen sind. Oft können sie sich auch nicht entscheiden, welchen Gedanken sie zuerst aussprechen sollen. Es kommt zu verschachtelten Sätzen und Gedankenabläufen, und oft werden Worte im doppeldeutigen Sinn verwendet. Dies sind die so genannten formalen Denkstörungen.
Störungen inhaltlicher Art sind Wahnvorstellungen. Sie schaffen dem Patienten Orientierung in der Außenwelt und befriedigen innere Bedürfnisse. Der Wahn hat die Funktion des Ausdrucks von nicht zugestandenen Wünschen und Bedürfnissen und dient der Abwehr von Konflikten.
Häufige Erscheinungsformen des Wahns sind der Verfolgungswahn, der Beeinflussungs- und Beziehungswahn, bei denen die Patienten sich beobachtet fühlen oder denken, unter dem Einfluss fremder Kräfte zu stehen, die sie zu unmoralischen und unsozialen Handlungen zwingen.
Die Gefühle und die gefühlsmäßigen Beziehungen zur Umwelt sind gestört. Die Gefühle der Patienten sind flach, d.h. sie sind nicht nur in der Intensität des Ausdrucks vermindert, sie scheinen auch an Gefühlen verarmt zu sein. Oft stimmen auch Mimik und Gestik nicht mit dem, was über Gefühle geäußert wird, überein, oder sie passen nicht zur Situation.
Darüber hinaus haben schizophrene Menschen oft nur wenig Beziehungen zu anderen Menschen und scheinen bindungsunfähig. Häufig haben sie zu einer bestimmten Person (häufig die Mutter oder der Beziehungspartner, d.h. eine nahe stehende Person) ein zwiespältiges Verhältnis. Sie sind an diese ihnen nahe stehende Person auf der einen Seite extrem gebunden, auf der anderen Seite wirken sie dann wieder interesselos.
Sie sind unentschlossen, und ihre Gleichzeitigkeit von Wollen und Nicht-Wollen kann ausgesprochen apathisch wirken. Fühlt der Patient sich bedroht, überwiegen Erregung, Spannung und Angst.
Bei Patienten mit der Diagnose Schizophrenie sind die unterschiedlichen Merkmale individuell verschieden ausgeprägt.
Es gibt einige Versuche psychodynamisch orientierter Therapeuten, die Entstehung einer schizophrenen Störung zu erklären. Mögliche Hypothesen sind folgende:
Ein wesentlicher Beitrag zur Entstehung und Entwicklung schizophrener Störungen wurde durch das Studium der Familienumwelt der als schizophren diagnostizierten Patienten gewonnen. "Es konnte festgestellt werden, dass Mütter solcher Patienten in einheitlich beschreibbarer Weise mit ihren Kindern umgehen: es fehlt eine herzliche Wir-Beziehung zwischen Mutter und Kind. Die Mutter ist unzugänglich für das, was das Kind ausdrücken möchte. Sie drängt sich auf und mischt sich ein (spaltet, treibt einen Keil dazwischen). Es besteht ein Zwiespalt zwischen sprachlich und gefühlsmäßig Vermitteltem, die Mutter liebt ihr Kind gleichzeitig und hasst es gleichzeitig, d.h., das Kind, das beides wahrnimmt, nämlich "Ich werde abgelehnt und ich werde geliebt" (, weiss nicht (reagiert gespalten), wie es auf die Mutter eingehen soll (Double-Bind-Theorie)" Dörner/ Plog, 1980, S. 119).
Ein weiteres Ergebnis der Familienforschung ist, dass in den Familien schizophrener Patienten keine eindeutige Rollenstruktur zu finden ist. Die Kinder und Heranwachsenden wissen häufig nicht, mit was sie sich an wen wenden können. Darüber hinaus sind die Familien in zwei Teile mit wechselseitiger Abwertung und Beschimpfung gespalten, so dass den Kindern die Möglichkeit zur Identifikation genommen ist.
Es resultiert die Annahme, dass eine fundamentale Störung des Zusammenlebens der Familie die Voraussetzung für eine langsame oder explosionsartige Spaltung ist.
Eine wesentliche Erkenntnis der soziologischen Forschung ist, dass schizophrene Erkrankungen in den untersten Sozialschichten häufiger als in den übrigen Sozialschichten vorkommen.
Mögliche Erklärungen dafür sind:
Eine weitere Erkenntnis ist, dass bei Menschen, die in Stadtkernen leben, die schizophrenen Anteile offener hervortreten als bei Menschen in Vorstädten.
"Umwelt beeinflusst die Wahrnehmung enorm, und es ist auch zu vermuten, dass dort, wo in der Umwelt das Gemüt nicht mehr angesprochen wird, die Widersprüche einer Industriegesellschaft besonders klaffend nebeneinander stehen, der Wahrnehmende ein Teil dessen wird, was er wahrnimmt, das wahr macht, was er wahrnimmt, zumal, wenn er nicht geschult ist, auf kritische Distanz zur Umwelt zu gehen" (Dörner/ Plog, 1980, S. 121).
Außerdem wurde festgestellt, dass bei schizophren diagnostizierten Menschen mehr Ledige vorkommen als in der vergleichbaren Durchschnittsbevölkerung. Dieser Befund trifft für schizophren diagnostizierte Männer eindeutiger zu als für Frauen. Entweder es ist so, dass die soziale Isolierung, die viele Ledige erleben, zur Spaltung führt, oder die Persönlichkeit so kontaktarm ist, dass sie wenig Bindungen hat.
Psychopharmaka (z.B. Neuroleptika) spielen eine wichtige Funktion in der Therapie. Sie lindern die Symptome (heilen aber die Krankheit nicht), können die Gespanntheit vermindern und den Patienten befähigen, über seinen Wahn hinaus mit anderen Menschen umzugehen, wobei aber auch Nebenwirkungen wie eine allgemeine Verlangsamung und Antriebslosigkeit auftreten. Die Medikamente gestalten auch die psychotherapeutische Arbeit einfacher.
"Will man an ihrem Selbst erkrankte Patienten über die beschriebene Alltagstherapie (Grundhaltung) hinaus mit systematischen oder speziellen psychotherapeutischen Verfahren erreichen, ist zu berücksichtigen, dass sie sich meist in einem oder mehreren Bereichen von der Umwelt zurückgezogen haben, in ihrer Phantasie anders wuchern als die, die in ihren Beziehungen krank sind, die eher übersozial sind und emotional und sprachlich besser äußerungsfähig sind. Es wird mehr Ausdauer, mehr Geduld verlangt, auch mehr Bemühen, den Sinn der Äußerung zu verstehen: was haben sie mit dem Selbst zu tun, wo ist die Anbindung an die Normalität gegeben, wo habe ich es mit Überwucherungen des Selbst zu tun. Die Anwendung psychotherapeutischer Verfahren ist dennoch sinnvoll, denn sicher sind psychotische Äußerungsweisen nicht sinnlos und motivlos, vielmehr liegt ihnen eine innere Auseinandersetzung zugrunde, deren Verständnis jedoch durch äußerst individuelle Überwucherung erschwert ist..." (Dörner/ Plog, 1980, S. 114).
Bei ein- und demselben Patienten wechseln sich häufig manische und depressive Zustände ab. Dies ist das typische Erscheinungsbild der manisch-depressiven Störung. Diese zählt zu einer der beiden häufigsten Formen der Psychose. Der Gemütszustand des Patienten pendelt zwischen der Depression auf der einen und der Manie auf der anderen Seite hin und her. Die Dauer der manischen und der depressiven Phasen kann variieren. In der Regel halten die depressiven Phasen länger an als die manischen (obwohl die manischen Phasen genauso gut zwei Stunden oder zwei Jahre andauern können). Depressive Phasen können sich ohne Behandlung durchaus über ein Jahr oder einen noch längeren Zeitraum erstrecken, und viele Patienten leiden unter häufigen vorübergehenden Depressionen und fühlen sich in den Phasen dazwischen völlig normal, wobei manische Schübe selten sind. Dagegen durchlaufen andere Patienten häufiger manische als depressive Phasen. Doch es gibt auch Patienten, bei denen manische und depressive Episoden immer eine bestimmte Anzahl von Tagen dauern und in einer absoluten Regelmäßigkeit aufeinander folgen.
Unter der manisch-depressiven Störung leiden ungefähr zwei bis drei Prozent der Bevölkerung (das ist zwei- bis dreimal so häufig, wie die Auftretenshäufigkeit der schweren Form der Schizophrenie).
Merkmal der manischen Phasen ist, dass der Patient im Gegensatz zu der depressiven Phase, in der er sich vor der äußeren Welt zurückzieht und motorisch gehemmt ist - als Zeichen seiner inneren Leere, der Erschöpfung und der Hoffnungslosigkeit - in der manischen Phase eine Überaktivität, extreme Redseligkeit, Ideenflucht, lockere Heiterkeit, Unbekümmertheit und Vernachlässigung sozialer Normen, sowie eine subjektive Gewissheit eigener Größe, Potenz und Macht festzustellen ist.
In der Psychoanalyse wird die Manie vorwiegend als antidepressiver Mechanismus angesehen. Nach Freud besteht bei der Manie ein klinisches Bild, dass sich spiegelbildlich zur Depression verhält. Der antidepressive Mechanismus besteht darin, dass mit Hilfe der Verleugnung von Trennung, Verlust wichtiger Personen und einem geringen Selbstwertgefühl sowie durch den Einsatz zusätzlicher künstlich erzeugter Inhalte und Überzeugungen, Betriebsamkeit und übertriebenem Aktionismus, der Entwicklung einer depressiven Stimmung und einer regelrechten Depression entgegengewirkt wird. "Die manische Heiterkeit, die Unbekümmertheit, die Vernachlässigung sozialer Normen, überhaupt >das Über-Bord-Werfen des Über-Ich< gehören zu dieser antidepressiven >Strategie<. Nicht eine biologisch fundierte und der depressiven entgegengesetzte Stimmungs- und Antriebslage sei der Grund für diese Veränderungen von Psychomotorik und Einschätzungen von Selbst und Welt, sondern umgekehrt: Die Mobilisierung der genannten Verleugnungsmechanismen, die massive Positivierung aller Erlebnisse und die ebenfalls defensive regressive Aktivierung des Größen-Selbst seien der Grund für Hochstimmung und vermehrten Antrieb" (Mentzos, 1995, S. 82-83). (Das Größen-Selbst bezieht sich auf eine Phase der kindlichen Entwicklung, in der das Kind seine motorischen Fähigkeiten entwickelt und damit verbunden ein Gefühl der Allmacht und Größe hat; regressiv bezeichnet das zeitweilige Zurückfallen auf die Gefühlswelt dieser kindlichen Entwicklungsphase.)
Doch die Manie ist noch mehr als ein antidepressiver Mechanismus. "Sie ist die Alternativlösung für dasselbe Problem, denselben Konflikt, dieselbe dilemmatische Konstellation, die auch zur Depression führt. Ich möchte dafür plädieren, die Manie als eine gleichsam >gleichberechtigte< Pseudolösung des depressiven Konflikts zu betrachten" (a.a.O., S. 84).
Betrachtet man die Manie rein als einen Abwehrmechanismus (wie die Verdrängung oder die Projektion), um den depressiven Gefühlszustand zu unterdrücken, verkennt man die in der Manie enthaltenen positiven Anteile und zwar den deutlichen, aber hilflosen, Versuch, sich von der mächtigen moralischen Instanz des Über-Ich zu befreien. "Mir scheint darüber hinaus, dass es sich hier um ein Aufkündigen des blinden Gehorsams dem strengen Über-Ich gegenüber handelt. Aber nicht nur diesem, sondern auch dem vernünftigen, der Realität und Logik sich anpassenden Ich gegenüber" (a.a.O., S. 86).
"Wichtig an dieser Stelle erscheint mir auch, das schon kurz erwähnte Positivum der Manie weiter zu erläutern. KRÖBER gehört zu den wenigen Autoren, die in mehreren Aufsätzen die verstehbare >Aussage< des Manischen zu formulieren und ihren positiven Inhalt aufzuzeigen versucht hat. Ein intuitiver Kliniker, sagt er (1992, S. 172), lerne in der Anschauung von drei Wochen manischer Verfassung mehr über die Nöte, Wünsche, Widersprüchlichkeiten, Hoffnungen, über das Wertgefüge des manischen Patienten als - wenn man Pech habe - nach Remission in einem Jahr Psychotherapie" Mentzos, 1995, S. 85-86).
Er geht soweit zu sagen, dass sogar viele wesentliche Wünsche, Ziele und Einblicke in die Persönlichkeit manisch-depressiver Menschen nur in dieser Zeit möglich sei.
Er konzentriert sich besonders auf den Inhalt des sprachlich geäußerten Inhaltes des Patienten und versucht zu zeigen, dass der Patient zwar in diesen Phasen extrem "geschwätzig" sei, aber nicht im eigentlichen Sinn ideenflüchtig, da er relativ beständig auf bestimmte zentrale Themen konzentriert bleibe, auch wenn es unzählige Variationen und Wiederholungen davon gibt.
Dipl.-Psych. Volker Drewes
Kollwitzstr. 41
10405 Berlin
Navigation
Über www.beratung-therapie.de